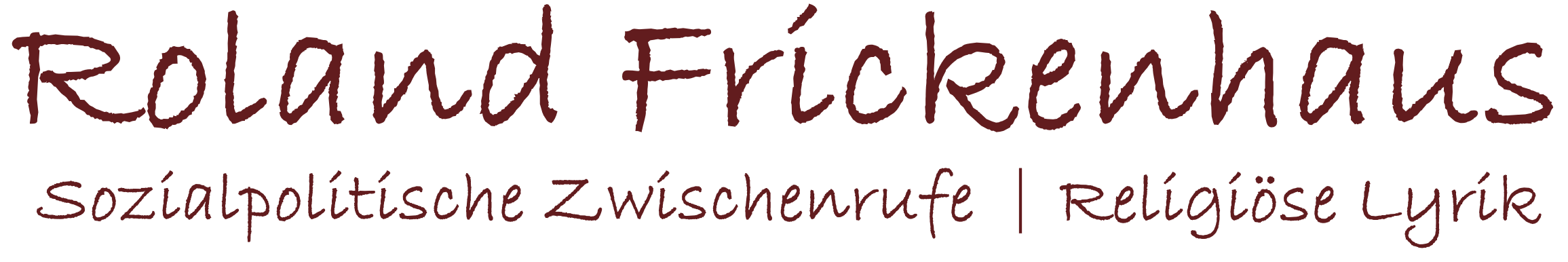Vorträge und Referate
"Kein Aufbruch ohne Ausbruch!“ Menschen mit Behinderung auf dem Weg zur Selbstermächtigung
Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis, Chemnitz, 28.10.2025
>> Teil 1 „Was Helfer behindert“ <<
Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich um Verständnis dafür bitten, dass ich auf das Gendern verzichtet habe. Das hat nichts mit einer Leugnung oder Abwertung von Vielfalt zu tun, im Gegenteil. Es hat vielmehr damit zu tun, dass ich mich nicht im Dschungel der Formulierungsvarianten verlieren möchte. Dafür ist mir das Thema zu wichtig...
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Liebe Kolleginnen und Kollegen,
dies ist ein besonderer Ort, an dem wir hier zusammen sind. Mir fällt es schwer, einfach mit dem Vortrag zu beginnen, wie man es vielleicht sonst immer so macht. Der Respekt vor den Menschen, die hier entrechtet und gedemütigt wurden, denen Gewalt angetan wurde und die der Willkür ihrer Schergen ausgesetzt waren, gebietet es, dass wir Nachgeborenen uns sensibilisieren und uns darauf zu verstehen lernen, miteinander gegen Unrecht aufzustehen, egal in welcher Form es uns begegnet.
Das Kaßberg-Gefängnis wurde von 1876/77 als „Königlich-Sächsische Gefangenenanstalt“ errichtet. Interessant ist der Bau auch aus architektonischer Sicht, denn man setzte hier das sogenannte „Panoptische Prinzip“ um. Über das uns „WIKIPEDIA“ wie folgt informiert: „Das Panopticon (von griechisch pān, ‚alles‘, und optikó, ‚zum Sehen gehörend‘), latinisiert auch Panoptikum, ist ein von dem britischen Philosophen und Begründer des klassischen Utilitarismus, Jeremy Bentham, stammendes Konzept zum Bau von Gefängnissen und ähnlichen Anstalten, aber auch von Fabriken, das die gleichzeitige Überwachung vieler Menschen durch einen einzelnen Überwacher ermöglicht.“
Wenige Jahre später, nämlich 1905, wurde nicht weit hier, und zwar in Chemnitz-Altendorf, die „Königlich-Sächsische Landeserziehungsanstalt“ eröffnet, die ebenfalls nach dem panoptischen Prinzip errichtet war. Aber auch Einrichtungen für psychisch kranke Menschen, wie etwa Großschweidnitz, Arnsdorf oder Rodewisch, wurden nach dem Panopticon-Prinzip errichtet. Stets ging es darum, einen möglichst umfassenden Blick auf die Patienten zu haben, um Kontrolle, Sicherheit und Betreuung zu verbessern. Auf der einen Seite also die Erleichterung für das Pflegepersonal und auf der anderen Seite die Disziplinierung der Patienten. Man kann also konstatieren, dass es darum ging, mit möglichst wenig Personal möglichst viele Menschen zu beaufsichtigen.
Und schon sind wir unserem Thema und wir haben zu realisieren, dass die Praxis, dass sich Menschen mit Behinderungen mit anderen Menschen mit Behinderung ein gemeinsames „Zuhause“ zu teilen haben, den Leitbildern jener Jahre entspringt und bis heute noch nicht völlig überwunden ist..
Und da ist es höchste Zeit, klar zu formulieren, dass es hierfür keinen einzigen fachlichen Grund gibt. „Fachlich sinnfrei und kontraproduktiv, aber ökonomisch interessant“, so lässt sich das Konzept der Heimbetreuung wohl am korrektesten beschreiben. Dass dieses Konzept sowohl für Politik und öffentliche Verwaltung als auch für die Sozialdienstleister nach wie vor interessant ist, macht es nicht einfacher. Wir aber merken uns: „Heime sind fachlich nicht notwendig, aber ökonomisch interessant".
Nun aber zum eigentlichen Vortrag, in dem ich gern auf fünf Sachverhalte eingehen möchte, die aus meiner Sicht für Helfende ein Problem darstellen. Ah, natürlich stellt das, was ich zuvor sagte, auch eine Behinderung für Helfende dar, denn schließlich können auch sie sich das Setting nicht basteln, in dem sie tätig sind.
So lautet also der erste Punkt, auf den ich näher eingehen möchte:
1. Helfer müssen funktionieren: Zwischen Tradition und allerlei Erwartungen
Als ich 1980 als ungelernte Kraft in einer großen diakonischen Einrichtung der Behindertenhilfe meine Arbeit begann, war dies für mich die Konfrontation mit einer Welt, die ich nicht kannte.
Um mich darin möglichst schnell zu orientieren, war ich bemüht, die Dinge so zu machen, wie sie meine Kollegen taten. Das heißt, dass ich nichts infragestellte, sondern nur Fragen stellte.
Mich möglichst geräuschlos eintackten, mitmachen und mithelfen, dass „der Laden läuft“. Ja, das dürfte wohl mein Selbstverständnis jener Jahre gewesen sein.
Dass man es damit relativ schnell auch zu einem sympathischen Kollegen schafft, liegt irgendwie auf der Hand.
Ich ging davon aus, dass ich es fachlich gut machen würde, wenn ich es nur so machen würde, wie es meine Kollegen mir vormachten. Erst allmählich dämmerte mir, dass dies ein Irrtum war, und dass es nicht darum geht, wie jemand etwas macht, sondern warum er das tut, was er tut. Ich hatte das Gefühl, in einem Geflecht unterschiedlichster Vorstellungen und Erwartungen zu sein.
Da ist der Arbeitgeber, mit dem man ein Vertragsverhältnis eingegangen ist und der seine Erwartungen in Stellenbeschreibungen, Dienstanweisungen, Belehrungen und sonstigen Schriftstücken recht deutlich formuliert hat. Auch die Nutzerinnen und Nutzer sind ein Vertragsverhältnis mit unserem Arbeitgeber eingegangen, aus dem sich unter anderem auch Ansprüche auf Leistungen ableiten. Und, als wäre das noch nicht genug, besteht auch zwischen Arbeitgeber und der Kommune/öffentlichen Verwaltung ein Vertragsverhältnis. Auch hier geht es um zu Zusagen, Erwartungen, Verpflichtungen und Ansprüche.
Der einzelne Mitarbeiter kommt also in ein mehr oder weniger festgezurrtes Gebilde, ebenso wie der Klient. Dass beide nicht die Wirkmacht haben, diese Architektur zu verändern, haben wir in den letzten 80 Jahren oft genug sehen können. Wenn sich also in der Teilhabe etwas signifikant ändern soll, dann wird das nicht mit den bunten Fahnen gelingen, die am 5. Mai auf dem Gelände von Wohneinrichtungen lustig im Wind flattern.
Bertolt Brecht hat einst formuliert: „Über das Fleisch, das euch in der Küche fehlt, wird nicht in der Küche entschieden!“ Übertragen auf unseren Bereich bedeutet das, dass über Ressourcen, die in der Teilhabe fehlen, nicht in der Teilhabe entschieden wird.
Um wessen Erwartungen geht es eigentlich in einer helfenden Beziehung? Ich erkannte schnell, dass die Erwartungen selten deckungsgleich sind. Die Bewohner, die wir damals noch "Behinderte“ nannten, wollten etwas anderes als die Leitung. Und meine Kollegen wollten dann etwas anderes, wenn ich nicht das wollte, was sie wollten.
Ja, was wollte ich eigentlich? War es ausreichend, sich mit den Erwartungen von Leitung und Kollegen zu identifizieren? Geht das überhaupt, wenn man sich gleichzeitig für die Umsetzung der Rechtsansprüche auf Teilhabe von Menschen mit Behinderung starkmacht? Wem bleibt man am Ende des Tages etwas schuldig?
Die eigenen Erwartungen reduzieren und sich irgendwie als Mitarbeiter in der „Sonderwelt Heim“ einrichten, getragen von dem wohlwollenden Blicken aus dem Bekanntenkreis, die eigentlich nichts anderes sagten, als dass sie meine Arbeit nicht machen könnten? Mache ich schon deshalb eine gute Arbeit, weil sich mein Arbeitsplatz dort befindet, wo sonst niemand arbeiten möchte?
Dass Menschen, die in helfenden Berufen tätig sind, ein überdurchschnittliches Risiko haben, ein Burnout zu bekommen, dürfte sich wohl durch den Umstand erklären, dass die Bedingungen und die unterschiedlichen Erwartungen weder erfüll- noch veränderbar sind. Dass der Körper dann in Form von Erschöpfung die Reißleine zieht, ist verständlich.
Es ist nicht einfach, sich in dem Geflecht unterschiedlichster Erwartungen zu orientieren. Ich kann aus eigener Erfahrung hier den Tipp weitergeben: Wenn Du nicht weißt, was jetzt aus heilpädagogischer Sicht das Richtige ist, dann mache es im Zweifelsfall so, wie Du willst, dass man es für Dich tut. Da liegt man immer richtig und hat vor allem eine gute Begründung.
Aber das ist nicht die einzige Herausforderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn
2. Helfer müssen liefern: Vom Kosten- zum Erfolgsdruck
Mit dem Bundesteilhabegesetz erreichte die Einrichtungen ein bis dahin für sie fremder Begriff. So ist in der Gesetzesbegründung zum § 128 BTHG, in dem es um das Recht des Kostenträgers geht, Einrichtungen zu prüfen, Folgendes zu lesen: „Da eine unwirksame Leistung nicht wirtschaftlich sein kann, ist die Wirksamkeit der Leistung vom Prüfrecht erfasst“. Natürlich liegt der Fokus auf dem Prüfrecht. An der Begründung aber merkt man, wie eindimensional der Gesetzgeber gedacht hat.
Wenn die von den in den Einrichtungen tätigen Mitarbeitern erbrachten Hilfeleistungen keine Wirksamkeit erzielen, betrachtet der Gesetzgeber sie als unwirtschaftlich und sind für ihn so etwas wie die Verschwendung öffentlicher Mittel. Eine Denke, bei der es einem gruselt und die bisher wohl deshalb so relativ unbeschadet davongekommen ist, weil man sich von dem Begriff der Wirksamkeit hat blenden lassen. Aber, Hand auf’s Herz: Es geht nicht um Wirksamkeit, sondern um Nützlichkeit! Und dann sind wir wieder da, wo wir den Opfern der Euthanasie versprochen haben, nie wieder hinkommen zu wollen.
Menschen, die Menschen mit Behinderung helfen, haben den Auftrag, Leistungen zu erbringen, die nachweislich wirken. Wie aber misst man Erfolg in der sozialen Arbeit? Was sind wir dem Gesetzgeber schuldig? Was ist eigentlich, wenn am Ende des Schuljahres zwei Kinder nicht versetzt werden? War dann der Schulunterricht nicht wirksam? Wem schuldet der Lehrer etwas? Und sollte man ihm gar kündigen, weil sein Unterricht nicht wirksam war? Wie ist das bei meinem Hausarzt? Schuldet mein Hausarzt meiner Krankenkasse meine Gesundheit? Immerhin bezahlt sie seine Leistungen und ich bin aber immer noch nicht gesund. Die Wirkung seiner Leistungen ist ausgeblieben.
Auch hierüber lässt sich länger diskutieren. Deutlich wird, dass dies in jeder Hinsicht ein dünnes Brett ist und dass sich eine Denke zurückmeldet, von der man zu Recht erwarten darf, dass sie seit ’45 in Deutschland keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt.
Helferinnen und Helfer, die Menschen mit Behinderungen unterstützen, haben also abzuliefern. Ihr Tun muss messbare Erfolge vorweisen. Wo dies nicht gegeben ist, hat ihr Arbeitgeber mit finanziellen Nachteilen zu rechnen, ist also im Endeffekt auch der eigene Arbeitsplatz gefährdet.
Wie aber misst man die Wirksamkeit eines Ausflugs in den Zoo? Welches sind die erhofften Wirkungen bei Herrn Mustermann und Frau Musterfrau? Wer entscheidet darüber?
Für die Mitarbeiter hat dies zur Folge, dass der bürokratische Aufwand deutlich zugenommen hat und Zeit eingesetzt werden muss, die der direkten Betreuung fehlt. Das ist eine Entwicklung, die der Arbeit nicht wirklich den ultimativen Kick gibt, sondern eher eine Motivationsbremse und ein Hindernis bei der Definition des beruflichen Selbstverständnisses ist. Damit meine ich nicht so sehr eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem beruflichen Selbstverständnis, sondern eher die allgemeine Frage, ob der Arbeitsplatz und der berufliche Alltag so sind, wie man sie sich vorgestellt hat. Man hat schließlich den Beruf erlernt, weil man Menschen helfen will und nicht, weil man gern am Schreibtisch sitzt.
Es gibt zudem viele Kolleginnen und Kollegen, die ihre helfende Tätigkeit auf Arbeitsplätzen erbringen, deren Finanzierung immer nur für einen befristeten Zeitraum gesichert sind. Sie können immer nur von Fördermittelbescheid zu Fördermittelbescheid und von Kostenzusage zu Kostenzusage planen und sich und ihre Arbeit organisieren. Das sind nicht gerade Bedingungen, die man als motivationsfördernd bezeichnen kann. Natürlich ist dies auch für die Klientinnen und Klienten schwierig. Hilfen können ebenso wegfallen wie Bezugspersonen. Sie werden mir sicher zustimmen, wenn ich festhalte, dass die keine günstigen Rahmenbedingungen sind, um wirksame Leistungen erwarten zu können.
Die Wirksamkeit hängt mitunter auch von der Funktionsfähigkeit von Teams ab. Da kann ein zu ausgeprägtes Harmoniebedürfnis zur Blockade werden. Der nächste Impuls:
3. Helfer müssen Blockaden überwinden: Von der Supervision zur fachlichen Streitkultur
Über viele Jahre dachte ich, dass es an mir liegt, wie es denjenigen geht, für die ich beruflich zuständig war. Geht es mir gut, geht es auch ihnen gut. Also bestand mein Bemühen darin, mir mit externer Hilfe über meine berufliche Situation Klarheit zu verschaffen und mich dadurch zu verbessern. Unser Arbeitgeber hatte einen Supervisor ausfindig gemacht, der zu regelmäßigen Zeiten zu uns in Team kam und dem wir unsere Sorgen, Fragen und Probleme schildern konnten. Mit seiner Hilfe tauschten wir uns zu verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohnern mit dem Ziel aus, uns zu optimieren.
Diese Zeit habe ich als durchaus hilfreich in Erinnerung. Allerdings würde ich mit dem heutigen Abstand auch sagen, dass es sich um ein typisches Muster handelte. Wenn die Axt stumpf ist, muss sie geschärft werden und wenn der Mitarbeiter fachlich ins Schwimmen kommt, dann braucht er externe Hilfe.
Das stimmt, ist aber nur der eine Teil der Medaille. Wir werden nicht nur dadurch besser, dass wir uns supervidieren lassen, sondern auch dadurch, dass wir uns zu fachlichen Themen streiten. Das ist schon wirklich komisch: Da halten wir beruflich durchaus viel von Vielfalt, wollen aber gerade da keine Vielfalt, wo es um uns und unsere beruflichen Sichtweisen geht.
Wenn man beruflich sehr von Diversität überzeugt ist und sie als Merkmal einer lebenswerten und menschlichen Gesellschaft ansieht, verwundert es umso mehr, dass unter uns kaum fachliche Dispute geführt werden. Da kommt uns professionellen Gutmenschen offensichtlich unser Harmoniebedürfnis in die Quere und lässt uns in eine Falle tappen.
Thomas Bauer hat vor einigen Jahren einen vielbeachteten Essay mit dem Titel "Die Vereindeutigung der Welt" geschrieben. Er stellt fest, dass überall, unabhängig wohin man schaut, ob in die Natur oder zu den Menschen und ihrer Kultur, eine „Tendenz zu einem Weniger an Vielfalt“ zu beobachten ist. Er plädiert dafür, Widersprüchlichkeit, Mehrdeutigkeit und Uneindeutigkeit als Vielfalt und Bereicherung zu verstehen. „Denn“, so Bauer, „genau dies ist unsere Welt: uneindeutig“.
Auch unsere Konzepte sind nicht eindeutig. Das beginnt bei der Frage, ob und warum Helfen Geld kosten muss und hört bei den unterschiedlichen Sichtweisen zu Inklusion auf. Gibt es wirklich nur Befürworter von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen unter uns? Hat hier vielleicht jemand einen Einwand gegen die Sonderwelten vorzutragen, in denen Menschen mit Behinderungen zu leben haben?
Welche Argumente gibt es für und welche gegen Hilfeplanung? Was bedeutet eigentlich Zukunftsplanung, wo doch Zukunft nicht planbar ist?
Sie haben sicherlich auch die Geschichte von dem Paar gehört, das sich entschlossen hatte, endlich zu heiraten. Sie gehen also zum örtlichen Pfarrer und bitten ihn, dass er sie trauen möge. „In all den Jahren, die wir uns nun schon kennen, haben wir uns noch nie gestritten“, bemerken sie nicht ohne Stolz. Daraufhin sagt der Pfarrer: „Da warten wir lieber noch ein bisschen mit der Trauung, gehen Sie nach Hause und lernen Sie erst einmal, zu streiten!“
Da steckt viel Lebensweisheit drin. Ja, auch unsere Arbeit wird eine bestimmte Qualität nicht erreichen, wenn wir uns nicht um inhaltliche Fragen und Positionen streiten. Vielfalt bereichert!
Der französische Moralist und Essayist Joseph Joubert hat eine Fülle kluger Gedanken zu Papier gebracht, ohne je ein Buch geschrieben zu haben. Ein Gedanke von ihm beschäftigt mich in diesem Zusammenhang. Er lautet: „Der eine sagt gerne was er weiß; der andere was er denkt.“
Ja, und so ist es auch: Wissen ist gleich, aber die Gedanken sind unterschiedlich. Und aus unterschiedlichen Gedanken generiert sich neues Wissen.
Wir müssen uns Zugänge zu dem erarbeiten, was wir denken und den Mut aufbringen, uns mitzuteilen. Wir müssen lernen, unsere eigenen Gedanken zu achten und ihnen Raum zu geben. Wir brauchen Diversität. Sie ist nicht bedrohlich. Bedrohlich ist das Gegenteil: Uniformismus, Gleichmacherei und Vereindeutigung. Von ihnen geht eine wesentlich größere Gefahr aus. Dies gilt für das gesellschaftliche
Zusammenleben genauso wie für unseren relativ kleinen Kosmos der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen.
Vielleicht installieren Sie mit Hilfe Ihres Supervisors oder Ihrer Supervisorin in ihren Einrichtungen so etwas wie Regeln für fachliche Streitgespräche. Wenn es sogar Ihr Gewaltschutzkonzept bis in den Rang einer Dienstanweisung geschafft hat, dann schafft dies eine „Leitlinie Streitkultur“ allemal auch.
Wie man streitet, ist nicht nur ein Qualitätsmerkmal guter Paarbeziehungen, sondern auch ein Merkmal fachlich guter Arbeit. Erinnert sei noch einmal an Joseph Joubert, der hierzu treffend feststellt: "Das Ziel eines Konflikts oder einer Auseinandersetzung soll nicht der Sieg, sondern der Fortschritt sein." In diesem Sinne: Etwas mehr Mut zur Vielfalt, was gleichbedeutend ist mit dem Mut zur eigenen Meinung.
4. Helfer müssen reflektieren: Das berufliche Selbstverständnis nach dem BTHG
Als ich vor mehr als vierzig Jahren in der Behindertenhilfe anfing zu arbeiten, gab es berufliche Leitideen, die sich heute merkwürdig anhören und die im wahrsten Sinne des Wortes aus der Zeit gefallen sind. Es ging um „satt und sauber“ und um die medizinische Betrachtung der Menschen, die wir damals noch „Patienten“ nannten und die auf „Stationen“ lebten und nicht in Wohnbereichen. Entsprechend der Leitgedanken überwogen medizinische Berufsbilder. Natürlich gab es einen Anstaltsarzt und verfügte die Einrichtung über ein eigens medizinisches Labor und eine Krankenstation. Entsprechend war es auch nicht ungewöhnlich, Kolleginnen und Kollegen in Kitteln anzutreffen.
Welches sind die heutigen Leitbilder und welches Selbstverständnis hat die Behindertenhilfe, nachdem seit 2009 die UN-BRK und dann, 2016, das BTHG bei uns geltendes Recht geworden sind? Welches berufliche Selbstverständnis braucht es, um die Gesetze bei der Entfaltung ihrer Wirkungen zu unterstützen?
Wenn die Behinderung als eine Einschränkung der gesellschaftlichen Teilhabe verstanden wird, die aus dem Zusammenspiel von individuellen Voraussetzungen und den jeweiligen Umweltbedingungen entsteht, dann kann sich dieser Gedanke nur entfalten, wenn er auch zum beruflichen Selbstverständnis der Helfenden wird!
Wie aber können Helfende auf Umweltbedingungen einwirken, die aus einer individuellen Einschränkung eine „Behinderung“ werden lassen? Was kann ein Arbeitgeber dazu in seine Stellenbeschreibungen schreiben? Ist das überhaupt realistisch?
Um zu verdeutlichen, was ich meine, konstruiere ich ein kleines Beispiel: Bei einem Träger ist Herr Mustermann tätig. Seine Aufgabe ist die Alltagsbegleitung. Er besucht regelmäßig Personen, die ohne seine Hilfe und Assistenz ihre Wohnung nicht verlassen können und begleitet sie zu Arztbesuchen, Einkäufen und sonstigen Wegen. Einer seiner Klienten, Opa Mustermann, der in seiner Mobilität stark eingeschränkt ist, wohnt an der Kreuzung Apfelweg, Ecke Birnenweg. Es gibt wohl Ampeln, aber keine abgesenkten Bordsteine. Mehrmals im Monat hilft also Herr Mustermann Opa Mustermann beim Überqueren der Straße.
Müsste es aber nicht nach dem neuen Verständnis von Behinderung auch zu Herrn Mustermanns Aufgaben gehören, bewusst übertrieben formuliert, sich einen Bagger zu nehmen, und die Bordsteine barrierefrei einzusetzen? Und, sollte das seine Kompetenz übersteigen, dass er es seinem Arbeitgeber meldet, der seit einigen Monaten eine eigene Baufirma betreibt und die Sache in Absprache mit der Kommune in Angriff nimmt?
Natürlich geht das nicht so einfach, ist schon klar. Aber es verdeutlicht, dass wir mit den bisherigen Strukturen das neue Verständnis von „Behinderung“ nicht umsetzten können.
Ein Freund von mir hat sich neulich ein E-Auto gekauft. Um es effektiv nutzen zu können, er wohnt im eigenen Haus, hat er sich nicht nur das Auto gekauft, sondern auch eine Wall-Box, mit der es ihm möglich ist, das Auto über Nacht zu laden.
Es kommt mir so vor, als haben wir mit dem BTHG wohl so etwas wie ein neues schickes E-Auto vor der Tür, aber im Eifer nicht an eine Wall-Box gedacht. Teilhabe und Inklusion brauchen Infrastruktur, sonst klappt das nicht.
Noch ist nicht erkennbar, dass wir Strukturen haben, in denen das neue Verständnis von Behinderung umgesetzt werden könnte. Das schafft nicht nur Frustration bei den Betroffenen, für die das BTHG geschrieben wurde, sondern auch bei denen, die den Betroffenen zur Seite stehen.
Aber nicht nur unser Stadtbild muss dem neuen Verständnis angepasst werden, sondern auch die Hilfestrukturen, an die wir uns über die Jahre gewöhnt haben und die uns vertraut sind. Um auch das so zu sagen, dass es nicht so glatt runtergeht: Für jeden abgesenkten Bordstein eine Sonderwelt weniger!, wenn Sie wissen was ich meine.
Helfende brauchen ein neues berufliches Selbstverständnis, sie brauchen angepasste Inhalte in ihren Ausbildungen und sie sollten damit dann in Strukturen tätig sein, die sich verändern lassen wollen. Alles andere macht aus dem neuen Verständnis von Behinderung ein Thema für Sonntagsreden.
5. Helfer brauchen einen Standpunkt: Von der Notwenigkeit ethischer Verortung
In Würdigung des besonderen Ortes, an dem wir uns hier befinden, möchte ich abschließend etwas zur Notwendigkeit einer ethischen Verortung von in helfenden Berufen tätigen Menschen sagen.
Früh fiel mir auf, dass es für die Mehrzahl meiner Kolleginnen und Kollegen zum beruflichen Selbstverständnis zu gehören schien, dass die dachten, etwas für Behinderte zu tun. Etwas für Menschen, die anders sind. Mit ihnen und ihrem Leben hatte das nichts zu tun. Menschen, die anders sind, brauchen etwas Besonderes, so werden sie wohl gedacht haben.
Und da gab es dann eben große Schlafsäle, Wohnbereiche, in denen die Bewohner den ganzen Tag in Strümpfen herumliefen, Bewohner, die man „fütterte“, während sie auf dem Toilettenstuhl saßen, und so fort.
„Du, Behinderte sind anders, das kannst Du nicht mit uns vergleichen! Die leben nicht ohne Grund in Sonderwelten. Und dass es in Sonderwelten für Menschen, die anders sind, auch anders zugeht, ist doch logisch!“
Die Botschaft: Vergleiche das hier nicht mit Dir und mir und vergiss Deine Vorstellungen von dem, was „normal“ ist. Hier gelten andere Regeln. Wenn Du es nicht schaffst, das in Dir abzuspalten, dann bist Du für den Job nicht geeignet. Das hier ist kein Job für Leute, die das nicht schaffen.
Wer sich mit dieser Denkweise und ihren Auswüchsen näher befassen will, dem empfehle ich, sich den Film „Die Hölle von Ueckermünde“ anzuschauen.
Und die Antwort auf die Frage, wie man es hinbekommt, noch einen Abschiedsgottesdienst auf dem Anstaltsgelände mit denen zu feiern, die man im Anschluss zu den Grauen Bussen geleitet, lässt sich hier finden.
Es stimmt nicht, dass das Böse banal ist. Banal sind die Mechanismen, die dem Bösen die Türen öffnen.
Die Geschichte der Behindertenhilfe ist eine Geschichte mit Pendelbewegungen in sehr gegenläufige Richtungen.
Von der fachlichen Vorzeigeeinrichtung bis zur Tötungsanstalt brauchte es nur wenige Jahre. Die Geschichte lehrt uns auch, dass die Behindertenhilfe eher anpassungs- als widerstandsfähig gegen ideologische Vereinnahmung zu sein scheint. Dass dies so ist, erklärt sich damit, dass sie auf der Grundlage von Gesetzen und Verordnungen funktioniert und auf öffentliche Zuwendungen angewiesen ist. Dass dies variable Faktoren sind, liegt in der Natur der Sache.
Wenn die Zusage „Nie wieder!“ nicht zum Feigenblatt werden soll, gleichzeitig aber ohne Ziel jeder Weg der richtige ist, brauchen Mitarbeitende ein Fundament. Menschen mit Behinderung zu unterstützen ist eben mehr als ein Job wie jeder andere.
„Bei uns im Ort hängt an einer diakonischen Pflegeeinrichtung ein Transparent mit der Aufschrift: „Pflege! Das hat Zukunft!“. Eine etwas sehr poröse Motivation, sich für einen sozialen Beruf zu entscheiden, weil er krisenfest ist. Kann man machen, wird aber unter Umständen nicht reichen. Und wie sich ein Spätdienst anfühlt, in dem wir von jemanden betreut werden, der sich für den Arbeitsplatz entschieden hat, weil er zukunftsfest ist, kann man sich gut vorstellen.
Damit man nicht unterwegs falsch abbiegt, braucht es Diskussionen und den regelmäßigen Austausch zu ethischen Werten. Das kann in Fortbildungen, Dienstberatungen oder Arbeitskreisen geschehen.
Meine Ausführungen zum ersten Teil, der die Blockaden, denen Helfer ausgesetzt sind, zum Inhalt hatte, möchte ich gern mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer abschließen. Es lautet: „Der Mensch lebt notwendig in einer Begegnung mit anderen Menschen, und ihm wird mit dieser Begegnung eine Verantwortung für den anderen Menschen auferlegt.“
Dem ist, so finde ich, nichts hinzuzufügen!
>> Teil 2 „Was Behinderten hilft“ <<
Ein denkwürdiges Gespräch am Kaffeetisch
Zum ersten gemeinsamen Kaffeetrinken habe ich mit David Dienst. Wir sind ungefähr fünfzehn Personen und ich bin der Neue. Entsprechend werde ich gefragt, wo ich herkomme, was ich zuvor gemacht habe und wie meine private Lebenssituation ist. Ich gebe brav Auskunft.
Und als ich das Gefühl habe, dass der größte Wissensdurst gestillt ist, bin ich nun an der Reihe, Fragen zu stellen: „Warum seid ihr eigentlich alle hier?“, ist meine erste Frage und ich sehe, wie meinem Kollegen David das Gesicht einschläft. Als sähe man das nicht und immerhin wüsste ich doch, wo ich arbeiten würde, so sagen seine Blicke.
Aber da sprudelt es auch schon aus einigen heraus und plötzlich höre ich Lebensgeschichten in denen es um überforderte Eltern, Ängste, „draußen“ nicht bestehen zu können und allerhand Persönliches geht und plötzlich führen wir ein sehr offenes und interessantes Gespräch. Mir wird klar: Wer nicht fragt, warum jemand in der Betreuung ist, enthält seinem Gegenüber die Möglichkeit vor, etwas Zentrales und Schwerwiegendes und Bedeutungsvolles von sich mitzuteilen.
Ich fasse das Gespräch zusammen und halte fest: „Da seid ihr also alle hier, weil ihr irgendetwas nicht könnt.“ „Und“, frage ich meinen Tischnachbarn Lennard, „was kannst Du denn nicht?“ Er sagt, dass er keine Uhr lesen kann und er fragt mich, ob ich ihm das beibringe. Ich lehne das ab.
David schaut mich erneut äußerst angespannt an. Und dann sage ich zu Lennard: „Ja, ich kann versuchen, Dir das beizubringen, aber nur dann, wenn Du mir auch etwas beibringst. Was kannst Du denn gut, Lennard?“ Er überlegt länger und dann hat er es: Er bietet mir an, mir im Gegenzug das Spielen mit der Spielekonsole, er spielt wirklich gut Autorennen, beizubringen. Da ist sie wieder, die Win-Win-Situation.
Wir treffen uns von nun an zu bestimmten Zeiten und ich bemühe mich, ihm das Uhrenlesen und er mir das Autorennen beizubringen.
Die Stärken stärken und die sog. „offengebliebenen Möglichkeiten“ ansprechen. Sich auf Augenhöhe zu begegnen heißt auch, sich über die Stärken zu begegnen. Es geht nicht um Mitleid.
Es wurde dann doch nichts mit dem Lesen der Uhr, aber das spielt hinterher nicht mehr die wirkliche Rolle, denn Lennard hatte sich schon lange ein System überlegt, wie er sich zeitlich orientieren konnte, ohne die Uhr lesen zu können.
Damit komme ich zu meinem ersten Punkt:
1. Was Behinderten hilft: Unterstützung und Kommunikation auf Augenhöhe
Zunächst und vorab: Weil der Umfang der Hilfe vom Ausmaß der Einschränkung abhängt, spielt sie insbesondere bei der Beantragung von Leistungen eine zentrale Rolle.
Je genauer die Dinge beschrieben sind, die ohne Unterstützung nicht bewältigt werden können, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass dies finanziell berücksichtigt wird.
Dies kann zu einer defizitorientierten Wahrnehmung führen und aus Menschen Antragsteller, Hilfeempfänger und Leistungsberechtigte machen. Das ist nicht Augenhöhe...
Weil jeder Mensch mehr ist, als sein Nichtkönnen, dürfen die individuellen Einschränkungen, die eine Person hat, nicht im Vordergrund stehen. Kein schönes Gefühl, wenn ich mir vorstelle, dass sich die Menschen, die sich mir zuwenden, dies nur deshalb tun, weil ich Defizite habe. Nicht ich als Person bin interessant, sondern mein Unterstützungsbedarf macht mich lukrativ.
Weil wir sind, haben wir das Recht, zu sein. Wir müssen uns dieses Recht nicht verdienen, sondern es begründet sich durch den Umstand unseres Daseins. Eine Gesellschaft, die zwischen „lebenswertem“ und „lebensunwertem“ Leben unterscheidet, zerstört sich am Ende selbst. Oder können Sie mir sagen, welche Kriterien ein „lebensunwertes“ Leben erfüllen muss? Sind es wieder die von 1933, vielleicht etwas modifiziert von den gesichert rechtsextremen Haudraufs unserer Tage?
Menschenrechte müssen verteidigt werden. Wir sollten wachsam sein, denn die Geschichte hat uns schon einmal gelehrt, dass die Klassifizierung zwischen „lebenswert“ und „lebenswert“, in „nützlich“ und „unnützlich“ auf eine schiefe Ebene führt.
”Wenn die Jugend sieht, daß dem Staat das Leben nicht mehr heilig ist, welche Folgerungen wird sie daraus für das Privatleben ziehen? Kann nicht jedes Rohheitsverbrechen damit begründet werden, daß für den Betreffenden die Beseitigung eines anderen von Nutzen war? Auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten mehr.", so das bekannte Zitat aus dem Brief von Theophil Wurm an den damaligen Reichsinnenminister Frick, in dem er gegen die Euthanasie protestierte.
Teilhabe und das, was wir „Behindertenhilfe“ nennen, ist immer auch politische Arbeit, denn sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Entfaltung und Entwicklung des Gemeinwesens.
Der Ort unserer heutigen Veranstaltung zeigt, welches Leid entsteht, wenn man Leben kategorisiert. Die Insassen waren die „Falschen“, die „Bösen“, auf die man herabschaute. Es ging um Bestrafung, Gefügigmachen und, wie man früher auch sagte, um „Korrektion“. Hier lebte man eingezwängt und fremdbestimmt.
Gefängnisse und Anstalten sind klassische Orte, von denen das ausgeht, was wir als "institutionelle -bzw. strukturelle Gewalt“ bezeichnen. Die Beziehungen waren quasi per se asymmetrisch.
Wir kommen aus dieser Denkweise, das ist unsere Geschichte! Und es braucht offensichtlich seine Zeit, sich dieser Geschichte vollständig zu entledigen und Vorkehrungen zu treffen, die eine Wiederholung unmöglich machen. Auch aus diesem Grund braucht es endlich eine rasche und konsequente Abkehr von den sonderweltlichen Strukturen, die ja noch aus jener Zeit stammen.
Man kann sich nämlich in Sonderwelten wie einem Heim, oder einer Werkstatt für behinderte Menschen, nicht auf Augenhöhe begegnen. Das ist ein Widerspruch in sich.
Für Menschen mit Behinderungen sind derlei Strukturen nicht hilfreich, im Gegenteil. Sie nützen wohl der Verwaltung und auch denen, die sich nichts anderes vorstellen können, sie sind aber nicht das, was die Betroffenen selbst wünschen. Und da haben wir noch nicht einmal die UN-BRK herausgeholt.
Aus dem asymmetrischen Hilfeansatz resultieren so problematische Sichtweisen wie beispielsweise Mitleid oder „für statt mit“, was wir in Pädagogendeutsch auch gern als stellvertretende Ausführung bezeichnen.
Von Fredi Saal, er war spastisch gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen, stammt der Ausspruch: „Warum sollte ich jemand anderes sein wollen?“ Als ich den Satz zum ersten Mal hörte, musste ich schlucken. Da sagt mir ein Mensch, der sein Leben lang auf Hilfe angewiesen war: „Warum sollte ich jemand anderes sein wollen?“
Er hat Recht und Mitleid hat nicht das Zeug, Menschen stark und selbstbewusst zu machen. Wenn wir wollen, dass Menschen anders sein sollen, weil unser Mitleid das so will, dann ist das keine gute Grundlage für achtsame und wertschätzende Hilfe.
Weil es die Persönlichkeit nicht achtet und das Gegenüber bevormundet, ist auch das „“für statt mit“ abzulehnen, das ebenfalls dem asymmetrischen Hilfeansatz entspringt. In der Regel stehen die professionellen Helfer unter einem großen Zeitdruck und da ist es eben einfach, schnell nachmittags schon die Brote für das Abendessen für alle zu schmieren und auch die Schuhe sind schneller zugebunden, wenn es der freundliche Mitarbeiter macht. Hilfe, die die Würde nimmt, ist keine Hilfe.
Bei möglichen Unsicherheiten hilft in der Regel die Beantwortung der Frage: „Wie hätte ich es denn selbst gern“?, sich zu orientieren.
Ein weiterer Punkt:
2. Was Behinderten hilft: Aufbruch durch Ausbruch: Empowerment und Vernetzung
Wenn man in Abhängigkeiten lebt, ist es schwierig, selbstbewusst und souverän aufzutreten. Wer Angst haben muss, dass er etwas verlieren kann, wenn er den Mund aufmacht und allzu fordernd auftritt, ist vorsichtig. Das Prinzip ist schon so alt wie die Menschheit und funktioniert bis heute, wie wir es zu unser aller Entsetzen jetzt in Amerika sehen können.
Menschen, die eingeschüchtert sind, die bevormundet werden und denen immer wieder deutlich gemacht wird, dass ihre Existenz fragil und unsicher ist, verlieren den Mut zu sich selbst. Sie können keinen Zugang zu ihren Stärken entwickeln, sich mit Selbstbewusstsein vollpumpen und so dem Schicksal die Stirn bieten.
Mit dem Stärken der Stärken und dem Überwinden mitleidsgeleiteter asymmetrischer Hilfeansätze können wir Menschen mit Behinderungen dabei unterstützen, diese Starre zu überwinden und sich auf den Weg der Selbstermächtigung zu begeben. In der Fachsprache ist die Rede vom Empowerment.
Wortwörtlich übersetzt bedeutet es „Selbstbefähigung“ oder „Selbstbemächtigung“.
Damit ist die Stärkung von Eigenmacht, Autonomie und Selbstverfügung gemeint. Es geht darum, dass Menschen ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen erkennen und nutzen, um selbstbestimmt über ihr Leben zu entscheiden. Gemeint ist die (Wieder-)Aneignung von Selbstbestimmung und die Fähigkeit, eigene Interessen und Bedürfnisse selbstbewusst zu vertreten.
Dass das nicht von Heute auf Morgen gelingt, sondern ein längerer Prozess ist, versteht sich von selbst. Ohne Unterstützung und Ermutigung wird es schwierig. Immerhin ist das eher ein Marathon und nicht ein Sprint. Und wenn wir uns vor Augen halten, aus welcher Geschichte die deutsche Behindertenhilfe kommt, dann braucht es ohnehin einen langen Atem.
Im Übrigen gelingt Empowerment besser, wenn sich auch die Unterstützer mit der Methode des Empowerment vertraut machen. Ihr berufliches Selbstverständnis muss sich anpassen. Sie müssen in der Lage sein, Empowermentprozesse anzustoßen und zu begleiten. Sie können Methoden vermitteln und Situationen mit Rollenspielen einüben und sich damit Schritt für Schritt vom asymmetrischen Hilfeverständnis verabschieden.
Wir können uns nicht stellvertretend ermächtigen, aber wir können Mut machen und uns gegenseitig unterstützen. Wir können Ansätze von Empowerment fördern und uns eine wertschätzende Haltung aneignen.
Sie haben vielleicht auch schon mal irgendwo im Internet etwas bestellt. Regelmäßig wird man im Anschluss aufgefordert, den Kauf und das gekaufte Produkt zu bewerten. Die Botschaft: Wir wollen besser werden, sage uns, was gut und was schlecht geklappt hat. Und längst sind die Rückmeldungen zu einem wichtigen Kriterium für unsere eigenen Kaufentscheidungen geworden.
Aber nicht nur für Händler und Hotels sind Rückmeldungen wichtig. Auch für ein Gemeinwesen sind Rückmeldungen wichtig, insbesondere die von Menschen mit Behinderungen. Geht es doch um so etwas bedeutungsvolles, wie die Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden und Kommunen. Dazu braucht es selbstbewusste und für sich sprechende Bürgerinnen und Bürger.
Die Lebensqualität eines Gemeinwesen lässt sich daran ablesen, wie sie Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen einbindet. Klaus Dörner hat immer wieder darauf hingewiesen, dass erst dann an alle Menschen gedacht ist, wenn man beim Bedürftigsten beginnt.
Zur Entwicklung der Stadt Chemnitz, beispielsweise, ist die Stadt auf dieRückmeldungen empowerter Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Die Stadt soll doch lebenswerter werden, oder? Das gelingt, wenn sich niemand ausgeschlossen fühlt.
Dazu braucht es Methoden und Strukturen. Aber, da alles wichtige im Herzen beginnt, braucht es erst einmal Betroffenheit und ein Bewusstsein abseits von Vorschriften, Paragrafen und Budgets.
Um noch einmal auf die mitunter recht penetrante Bitte, einen im Internet getätigten Kauf zu bewerten, zurückzukommen: Die Vorstellung, man würde eine Kommune, die ihren Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderungen Aussonderung und Separierung anbietet, mit „Dislikes“ auf ihrer Homepage bewerten, ist schon irgendwie spannend.
Es braucht also nicht nur Empowerment, sondern auch eine entsprechende Verwaltungsstruktur. Wenn Sender und Empfänger auf unterschiedlichen Frequenzen unterwegs sind, wird es nichts mit der Umsetzung der UN-BRK.
Aufgrund ihrer Aufgabenstellung kommt der öffentlichen Verwaltung eine besondere Verantwortung bei der teilhabegerechten Entwicklung des Gemeinwesens zu. Und da geht es Menschen mit Behinderungen wie aktuell der deutschen Wirtschaft: Weniger Bürokratie bitte!
So lautet der nächste Punkt:
3. Was Behinderten hilft: Weniger Bürokratie
Mir ist es nach wie vor ein Rätsel, wieso die Umsetzung der Teilhabe so verbürokratisiert geschieht. Natürlich geht es um den Einsatz von Steuermitteln und um die Rechenschaftspflicht derjenigen, die darüber zu entscheiden haben.
Das ganze Prozedere um die Hilfebedarfsermittlung beispielsweise, ist ein aufgeblähtes Konstrukt, das Ressourcen verschlingt die dann dort fehlen, wo sie benötigt werden: beim Hilfeempfänger. Ganz abgesehen davon, dass sie zweifelhafte Ergebnisse liefert.
An einem kleinen Beispiel möchte ich verdeutlichen, warum es aus fachlicher Sicht schwierig ist, den Hilfebedarf einer Person exakt zu ermitteln. Das ist ja ein sehr bürokratisch aufwendiger Vorgang, der am Ende ein fachlich bedenkliches Ergebnis generiert.
Wenn Sie in Chemnitz auf dem Hauptbahnhof stehen, sich eine Fahrkarte kaufen wollen um nach Zwickau zu fahren, dann bekommen Sie das unter Umständen allein und ohne Hilfe hin. Sie haben Keinen Hilfebedarf. Wenn Sie allerdings in Shanghai auf dem Hauptbahnhof stehen und nach Peking wollen, werden Sie wohl ohne Hilfe nicht zurechtkommen. Ihre Kompetenzen reichen für den Kontext „Hauptbahnhof Chemnitz“ aus, aber in Shanghai helfen Sie Ihnen nicht.
Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass der Hilfebedarf einer Person immer nur für den Kontext gilt, in dem er erhoben wurde.
Wer in Chemnitz ohne Hilfe zurechtkommt, für den sieht es in einem anderen Kontext, wie Beispielsweise der Bahnhof in China, schon ganz anders aus. Auf unsere Situation bezogen heißt das nichts anderes, als dass sich bei einem im Heim lebenden Menschen verlässlich nur der Hilfebedarf ermitteln lässt, den er benötigt, um dort leben zu können.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Hilfebedarfsermittlung und -planung mit allerhand Dokumentation und sonstigen bürokratischen Aufwand verbunden ist und dass hierfür Zeit aufgewandt wird, die den Klienten fehlt.
Und auch für die Leistungsberechtigten stellt das Beantragen von Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz oder das Beantragen von Hilfsmitteln oder von Assistenz eine Hürde dar und wird oftmals als massiv bürokratisiert beschrieben. Die Betroffenen haben viele Nachweise, Anträge und Wiederholungsanträge einzureichen, wodurch Zeit und Energie verloren gehen. Das ist insofern entwürdigend, weil das oftmals bedeutet, die eigene Behinderung ständig neu beweisen zu müssen.
Es gibt in der Behindertenhilfe so einige Glaubenssätze, die es bis ganz nach oben geschafft haben, ohne sich begründen zu müssen. Einer dieser Sätze lautet: Je mehr Fachkräfte, desto bessere Teilhabeergebnisse.
Mit Verlaub: Wie wissenschaftlich untersetzt ist eine Personalrelation von 1:5? Das ist, Hand auf’s Herz, nicht das Ergebnis einer wissenschaftlichen Evaluation,sondern das Ergebnis einer Aushandlung zwischen Verwaltung und Leistungserbringern. Mehr nicht.
Natürlich steht man in der Gefahr, mit solchen Aussagen von zwei Seiten Dresche zu beziehen, aber das nützt nichts. Es geht um die Sache und ich empfinde das „Fachkraftmantra“ als eine zweischneidige Sache. Denn es verteuert Leistungen und führt im schlimmsten Fall dazu, dass keine Leistungen gewährt werden, weil Fachkräfte fehlen. Es muss kein „Mercedes“ sein, es geht auch mit einem „Opel“.
Das, meine verehrten Damen und Herren, ist ein gesondertes Thema, zu dem es viel zu sagen und zu streiten gibt. Solange aber niemand wissenschaftlich begründen kann, warum welcher Fachkraftanteil bei welcher Behinderung zwingend einzuhalten ist, ist gut abzuwägen, welches für Hilfebedürftige das kleinere Übel ist: Keine oder weniger Hilfe und ein mögliches Schließen der Einrichtung, weil die Fachkraftquote nicht stimmt und sozusagen keine Hilfe besser ist, als die von zu vielen Hilfskräften, oder Kontinuität in der Hilfegewährung mittels reduzierter Fachkraftquote. Bürokratie landet nicht immer Treffer, selbst wenn sie in guter und edler Absicht unterwegs ist.
Es steht so etwas wie die Entbürokratisierung der Teilhabe an. Das ist eine Mammutaufgabe, die am ehesten Erfolg verspricht, wenn sie gemeinsam erledigt wird. Also eine Art Gemeinschaftsaufgabe derjenigen, die das sogenannte „leistungsrechtliche Dreieck“ bilden. Stichwort: „Runder Tisch Entbürokratisierung der Teilhabe“. Weil in der Teilhabe viele Regelungen in bundes- bzw. landesrechtlicher Hoheit liegen, ist dies nicht so ganz einfach.
Für die allenthalben zu erstellenden Aktionspläne sieht es dagegen schon wieder ganz anders aus.
Wir haben uns an folgende Redewendung gewöhnt. Irgendwo ist eine Katastrophe geschehen und dann blickt irgendjemand betroffen in die Kamera und sagt: „Wir werden schnell und unbürokratisch helfen.“ Das klingt erst einmal gut und beruhigt die Gemüter. Aber eigentlich bedeutet es doch nichts anderes, als dass sich „schnell“ und „bürokratisch“ ausschließen. Hilfe, die schnell greifen soll, kann nicht bürokratisch sein, das ist nicht miteinander vereinbar und fast so etwas wie ein Widerspruch.
Wenn „schnell“ und „Bürokratie“ nicht harmonieren und es aber um „schnell“ geht, dann muss Bürokratie gedrosselt werden.
4. Was Behinderten hilft: Eine nutzbare Umwelt und Menschen mit Sozialkompetenz
Ich möchte mit einem merkwürdigen Vergleich beginnen: Meine Enkeltochter ist fünf Jahre alt und ungefähr 110 Zentimeter groß. Wieso lebt sie eigentlich in einer Wohnung mit Wänden von 220 Zentimetern? Zum Glück ist niemand auf die Idee gekommen, spezielle Häuser zu bauen, die nur für Kinder geeignet sind. Und was ist, wenn sie mal 80 ist und die Treppe zum Problem wird?
Woher kommt das Verständnis, Häuser so zu bauen und damit auch eine Infrastruktur zu schaffen, die nicht dauerhaft nutzbar ist? Bei Häusern für Kinder leuchtet sofort ein, dass das irgendwie Quatsch ist. Aber wie ist das mit Häusern, die nur für Mobilitätsuneingeschränkte gebaut wurden? Daran haben wir uns, so scheint es, gewöhnt. So ist halt der Lauf der Dinge, denken wir. Aber: Ist er das wirklich? Hier ist es noch nicht normal, verschieden sein zu können.
Was Menschen mit Behinderungen genauso hilft wie denen ohne Behinderung, ist die Erkenntnis, dass das, was eine Gemeinschaft für Menschen mit Behinderungen tut, sie auch für sich tut. Wir gestalten uns unsere gemeinsame Umwelt freundlicher und lebenswerter, wenn sich in ihr Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt und selbstbestimmt bewegen können.
Es geht letztlich nicht um Almosen für eine „nörgelnde Randgruppe“, sondern um die Investition in eine lebenswerte Infrastruktur, Uns kommt das vielleicht manchmal auch deshalb so schwierig vor, weil wir aus einer anderen Tradition kommen, wie eingangs im Zusammenhang mit der Architektur dieses Gebäudes bereits erwähnt.
Menschen mit Behinderungen hilft es in diesem Zusammenhang auch, wenn sie in einem Gemeinwesen leben, in dem sie sich auf das Verständnis ihrer Mitmenschen verlassen können. „Behinderung beginnt im Kopf“, so haben wir damals gesagt.
Barrierefreiheit allein ist kein Garant für Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe, allerhöchstens so etwas wie eine Vorbedingung. Das Eigentliche geschieht im Kopf.
Es braucht Initiativen, mit denen einer gesellschaftlichen „Verichung“ vorgebeugt werden kann. Es geht um Programme und Ideen, wo und wie Bürgerinnen und Bürger neue Sozialkompetenzen erlernen und verbessern können. Auf der großen Bühne geht es da um die Forderung nach einem Sozialen Pflichtjahr und einer stärkeren Gewichtung des Sozialen in den Lehr- und Unterrichtsplänen der Schulen, die Einführung eines Pflichtfaches für „Soziales“, beispielsweise.
Wir haben mittlerweile barrierefreie Zugänge, können Kulturveranstaltungen besuchen und ohne fremde Hilfe den ÖPNV nutzen, aber gibt es auch Menschen, die über die entsprechenden Sozialen Kompetenzen verfügen, um Zusammenhänge zu erkennen? Denn das, was wir „Behindertenfreundlichkeit“ nennen, ist etwas anderes als „Barrierefreiheit“.
Für das Gemeinwesen ist die Unterstützung für Menschen mit Behinderungen in jedem Fall eine Win-Win-Situation, von der nicht nur die Betroffenen profitierten, sondern das gesamte gemeinschaftliche Gefüge des sozialen Miteinanders von Menschen mit und ohne Behinderung.
Damit möchte ich zum letzten Punkt kommen:
5. Was Behinderten hilft: Sicherheit, Verlässlichkeit und Vertrauen
Mir fiel wieder die Antwort eines kleinen Mädchens ein, das gefragt wurde, was denn der Unterschied zwischen „Kopf“ und „Herz“ sei. Ihre Antwort: „Das, was ich im Kopf habe, das weiß ich und das, was ich im Herzen habe, das tue ich.“
Das ist oftmals eine schwierige Balance zwischen Kopf und Herz. Und zwischen Wissen und Tun gibt es mitunter große Lücken. Es lohnt nicht, diesen Umstand zu beklagen, das ist wohl menschlich. Wichtig ist aber, daran zu arbeiten, dass sich die Lücke schließt und sich der Grad der Deckungsgleichheit erhöht.
Es gibt zwei Kontexte, in denen es überdurchschnittliche Auswirkungen hat, wenn die Unterschiede zwischen Reden und Tun zu groß werden: Das sind die Kirchen und das ist die Politik. Da entstehen Schäden und da geht Vertrauen verloren.
Gut, man kann seine Erwartungen reduzieren, das wäre eine Variante. Von ihr zeugen leere Kirchenbänke genauso wie Wahlbeteiligungen von wie zuletzt bei der Chemnitzer Stadtratswahl, an der sich gut 65% der Wahlberechtigten beteiligt haben.
Die zweite Variante ist, dass man etwas vorsichtiger mit dem Mund ist. Enttäuschung stellt sich ein, wenn Versprechen und Zusagen nicht erfüllt werden. Das gilt für markige Sonntagsreden genauso wie für Gesetze und Verordnungen, die ja ebenfalls Zusagen und Garantien enthalten.
Um als Individuum am Leben in einer inklusiven Gesellschaft selbstbestimmt teilhaben zu können, sind Menschen mit Behinderungen im besonderen Maße auf öffentliche Unterstützung angewiesen. Also auf einen der Akteure, bei denen es besonders heikel ist, wenn die Lücke zwischen Kopf und Herz, zwischen Verordnung und Ausführung, zwischen Theorie und Praxis zu groß wird.
Ich weiß schon, dass das nicht so geschmeidig klingt, wie man es gern hätte. Es ist aber die Realität. Wir dürfen das ohnehin oftmals fragile Selbstbewusstsein von auf öffentliche Unterstützung angewiesenen Menschen nicht noch weiter durch unerfüllbare oder unerfüllte Versprechen schwächen.
Es geht um Verlässlichkeit, Sicherheit und Vertrauen. Nicht nur der Assistent, der mich beim sicheren Überqueren der Straße unterstützt, gibt mir Sicherheit, sondern auch die Gewissheit, dass mein Antrag auf das Merkzeichen „G“ im Schwerbehindertenausweis schnell und ohne viele Schnörkel beschieden und bis zu einem mir zuvor mitgeteilten Termin in meinem Briefkasten sein wird.
Der britische Psychologe William McDougall, er lebte von 1871 bis 1938, hat einmal Folgendes gesagt: "Gegenseitiges Vertrauen ist wichtiger als gegenseitiges Verstehen. Wo das Verstehen nicht zum Ziele führt, möge das Vertrauen seinen Platz einnehmen."
Vor dem Verstehen, und manchmal auch vor dem Verstehen-wollen, kommt das Vertrauen!
Ein schönes Schlusswort, wie ich finde.
In diesem Sinne: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT!
Zurück zur Übersicht der Vorträge und Referate