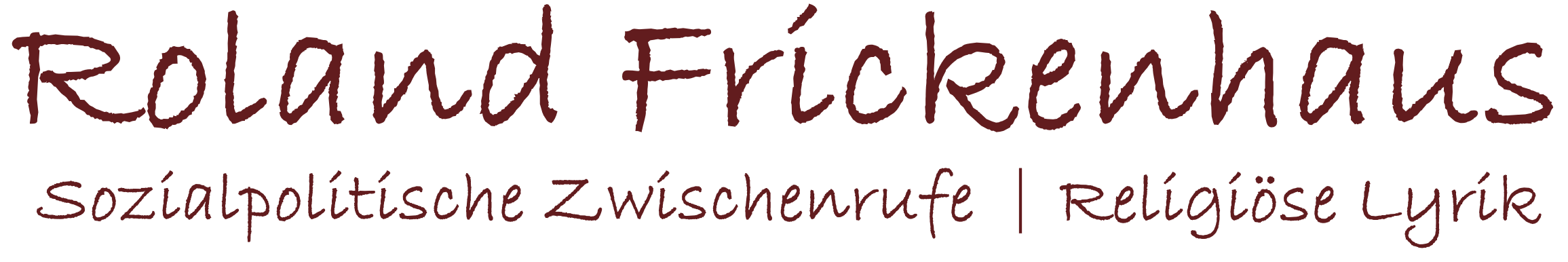Zwischenruf März 2025
WAS, wenn nicht wir? (Teil 1)
Zur Zeit finden sich allerhand Bücher, die in ihrem Titel das Personalpronom "WIR" verwenden. Es scheint, als sei allmählich aufgefallen, dass alles um uns herum auch irgendwie mit uns zu tun hat: Klima und Umwelt, Wirtschaft und Politik oder Bildung und Kultur, um nur einige zu benennen.
Sträflich unterrepräsentiert ist jedoch der ganze Sozialbereich. Natürlich liest man hier und da etwas zur Rente, zur demografischen Entwicklung oder zu Kitas und den Herausforderungen im Pflegebereich. Was fehlt, ist eine Diskussion zu der Frage, woran das liegt und welches der für Soziale Themen gesellschaftlich angemessene Stellenwert sein könnte. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass unsere kapitalistisch orientierte Gesellschaftsordnung „Soziales“ eher als eine Art Störung und Beeinträchtigung ihres Handelns empfindet.
Am 22. Februar 2024 generiert „DIE ZEIT“ mit der Schlagzeile „Der Betreuungsmangel gefährdet unser Geschäftsmodell“ erhebliche Aufmerksamkeit. In dem Artikel stellen DAX-Vorstände und Spitzenkräfte aus Unternehmen dar, dass fehlendes Kita-Personal erhebliche Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Unternehmen hat. Denn, wenn eine Kita wegen fehlendem Personal keine Betreuung anbieten kann, und Eltern ihre Sorgeaufgaben nicht anderweitig abgeben können, dann fehlen sie in den Betrieben, was wirtschaftliche Einbußen der Unternehmen zur Folge hat. Die äußerst nüchterne Schlussfolgerung der Wirtschaft lautet: Die Kita-Krise ist keine Privatsache! Sieh an, sieh an.
Vergessen wir also die pädagogischen Konzepte von "Waldorf" und "Montessori" und merken uns, dass die Aufgabe einer Kita darin besteht, den Eltern den Rücken freizuhalten, damit diese den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Arbeitgeber ermöglichen. Ja, und merken wir uns auch, dass private Sorgeaufgaben, also Soziales Tätigsein von Beschäftigten, nicht gut ankommt. Für Betriebe ist „Sozial“ genauso eine Störung, wie etwa ein Lieferengpass oder ein Stromausfall.
So ist es wohl eher folgerichtig als subversiv, zu fragen, ob es überhaupt fachliche Notwendigkeiten für Kitas gibt. Also: Brauchen (auch…) Kinder eine Kita? Welche pädagogische Notwendigkeiten könnte es eigentlich geben, sie morgens um sechs Uhr in die Kita „Pippi Langstrumpf“ zu bringen und sie dort dann irgendwann am Nachmittag wieder abzuholen? Wie würden sie sich entwickeln, wenn man dies nicht täte?
Kinder, um den mühseligen Weg um den heißen Brei abzukürzen, brauchen keine Kita, sondern es ist das System, das ohne Kitas nicht funktioniert. Was also die Erzieher*innen in den Kitas letztendlich leisten, ist, dass sie der Wirtschaft helfen, Profite zu generieren, indem sie stellvertretend Sorgeaufgaben für deren Beschäftigte übernehmen, die somit für ihre Arbeitgeber verfüg- und planbar sind.
Beschäftigte, die sich über ihren Job definieren, sind für die Unternehmen durchaus willkommen, weil sie davon ausgehen können, dass auch sie eher das Soziale als eine Art Störung ansehen werden. Um der Kinder willen muss man keine Kita betreiben. Und so nimmt es nicht Wunder, dass es natürlich auch Stimmen gibt, die das Konstrukt Kita kritisch sehen.
Natürlich sind auch Senioreneinrichtungen und Wohnheime für Menschen mit einer kognitiven Einschränkung oder einer psychischen Erkrankung fachlich nicht notwendig. Hier ist der Befund ähnlich: Sie haben ihren Sinn, weil sie Störungsfreiheit durch die Übertragung von Sorgeaufgaben an professionell Tätige garantieren, nicht aber, weil sie eventuell Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner verbessern würden. Um der behinderten Menschen willen muss man keine Sonderwelten wie Wohnheime oder Werkstätten betreiben. Da besteht mittlerweile ein breiter fachlicher Konsens.
Es geht aber nicht um die Frage von Pro und/oder Contra dieser Angebote, sondern um die Frage, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt, wenn ihre Mitglieder mehrheitlich zu der Einschätzung gelangt sind, Soziale Sorgeverantwortung als Störung anzusehen, die man am besten an Profis delegiert. Wie sozial kompetent sind ihre einzelnen Mitglieder, wenn sie „Sozial“ nicht mehr können müssen, weil es für nahezu sämtliche Bedarfslagen professionelle Angebote und Unterstützung gibt?
Für den alten Homo socialis sieht das nicht allzu gut aus und es drängt sich die Frage auf, wieviel von ihm, dem einstmals sozialen Wesen, auf dem Weg zum Homo oeconomicus noch übriggeblieben ist.
Welche Gesellschaft entsteht, die "Sozial" nicht mehr kennt und kaum noch kann, weil mittlerweile für nahezu alle Bedarfssituationen professionelle Angebote existieren? Wie entwickeln sich die MItglieder einer Gesellschaft, in der das Soziale zu einer Ware geworden ist?
Finanziell lässt sich das relativ sachlich und korrekt ermitteln. So sind beispielsweise die Beiträge zur Pflegeversicherung seit dem Jahr 2000 um gut 1,9 Prozentpunkte gestiegen, der Eigenanteil für einen Pflegeheimplatz stieg im selben Zeitraum um zweitausend Euro, nämlich von gut 950€ auf aktuell bis zu 3.000€. Und ein Kita-Platz, der heute auch schon mal 350€ kosten kann, war seinerzeit für einen Betrag zwischen 20 und 115€ zu haben. Das durchschnittliche Renteneintrittsalter lag bei 62,3 Jahren und beträgt heute für Personen, die 1964 oder später geboren wurden, 67 Jahre.
Ach, und im Jahr 2000 waren allein in der Wohlfahrtspflege gut 1,16 Millionen Menschen beschäftigt und aktuell sind es rund 2 Millionen.
Aber wie sieht es mit dem Teil aus, den man nicht so einfach quantifizieren kann? Im gesellschaftlichen Bewusstsein ist offensichtlich noch nicht angekommen, dass der Preis für unseren Wohlstand nicht nur eine beschädigte Umwelt ist, sondern auch eine zunehmend sozial inkompetente Gesellschaft. Die Folgen des kontinuierlichen Verschwindens Sozialer Kompetenzen ist längst zu einem gesellschaftlichen Problem geworden, das allerdings nicht die Aufmerksamkeit generieren kann wie beispielsweise unsere Bedrohung durch den Klimawandel.
Hinzu kommt, dass sich sofort professionelle Gutmenschen an die Startlinie begeben und nur auf den Startschuss irgendeines Fördermittelgebers warten, um dann nach tradierter Sitte loszulegen. Man kann sein Geld mit dem Anbau von Kartoffeln genauso verdienen wie mit Suchthilfe. Es wäre schade, wenn beispielsweise die aktuelle DAK-Mediensuchtstudie die berichtet, dass 25% aller 10 bis 17jährigen Soziale Medien riskant oder krankhaft nutzen und 4,7 Prozent von ihnen gar schon süchtig sind, (wieder nur…) zu einer Weiterentwicklung Sozialer Angebote führen würde, die längst überfällige öffentliche Debatte zum gesellschaftlichen Stellenwert des Sozialen aber (wieder einmal…) unterbliebe.
Wenn mehr als 700.000 (!) Kinder und Jugendliche Onlinespiele riskant oder krankhaft nutzen, dann fragt man sich, was Sozialprofis noch alles erledigen sollen, ehe wir uns die Mühe machen, einmal darüber nachzudenken, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, oder ob wir nicht schon viel zu lange an Symptomen herumdoktern und zu wenig über Ursachen nachdenken.
Ein Soziales Pflichtjahr, gezielte Konzepte zum Erlernen Sozialer Kompetenzen, die schon im Kleinkindalter beginnen und sich dann über Schule, Ausbildung und Studium erstecken, Ethik- und Sozialkunde, Nachbarschaftliche Initiativen, Ausbau und Förderung des Ehrenamtes und finanzielle Unterstützung ehrenamtlich Tätiger, stärkere finanzielle Entlastung für Menschen, die in ihren Familien Sorgeaufgaben übernommen haben, da lässt sich schon Einiges diskutieren.
Der Königsweg ist das Auslagern des Sozialen nicht. Wir zahlen unseren Wohlstand nicht nur mit der Ausbeutung der Natur, sondern auch mit einer zunehmend sozial inkompetenten Gesellschaft, zu der über kurz oder lang dann eben auch besagte 700.000 (!) Kinder und Jugendliche gehören dürften, die irgendwann einmal erwachsen werden und denen wir den Staffelstab in die Hand zu geben haben.
Ein guter Anfang ist gemacht, wenn sich ein gewisses Unbehagen bei der Vorstellung, wie es sich in einer Gesellschaft leben lässt, in der sich das WIR immer mehr auflöst und in lauter ICHs zerbröselt, einstellt...